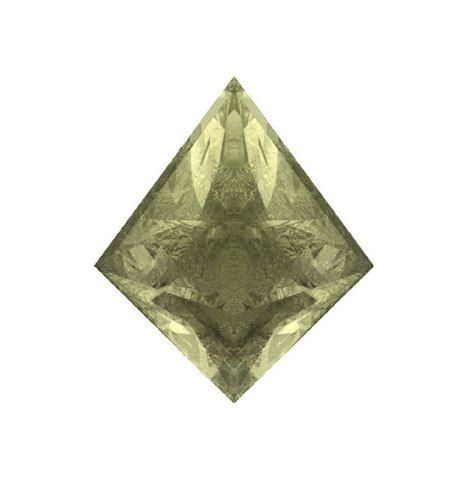Nicht nur in der Eurozone, sondern auch in anderen Teilen des Globus hat die Inflation zuletzt neue zyklische Tiefs erreicht. Vielerorts treibt das die Sorgenfalten auf die Stirn der Notenbanken. Die EZB hat auf ihrer jüngsten Sitzung zwar noch keine neuen Maßnahmen ergriffen, um den disinflationären Tendenzen entgegenzusteuern, die Türen für ein mögliches Eingreifen – sowohl konventioneller als auch unkonventioneller Art – aber deutlich aufgestoßen. Es dürfte demnach wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis die Wäh- rungshüter in Form einer weiteren Lockerung aktiv werden. Die schwedische Notenbank hat mit Blick auf die rückläufige Inflationsentwicklung bereits im Dezember die vermeint- liche Reißleine gezogen und den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 % gesenkt. Bisher lässt sich allerdings nicht erkennen, dass die Maßnahme Wirkung zeigt: In den ersten beiden Monaten des Jahres lag die Teuerung in der Jahresrate mit -0,2 % im deflationären Bereich, und eine Besserung ist nicht in Sicht. Die Riksbank zeigte sich zuletzt besorgt darüber, dass die Preisentwicklung auf dem niedrigen Niveau verharrt und ist entsprechend offen, den Leitzins erneut zu senken. Das gilt umso mehr, seit das NBER (National Bureau of Economic Research) in seinem jüngsten Forschungsbericht in Frage gestellt hat, dass ein niedrigerer Leitzins wirklich eine höhere Haushaltsverschuldung, der anderen Baustelle der schwedischen Währungshüter, begünstigt. Man gehet deshalb davon aus, dass die Riksbank auf ihrer Sitzung am Mittwoch beherzt eingreift und den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 0,50 % reduziert. Nur einen Tag später, am Donnerstag, entscheidet die Bank of England über ihren künftigen geldpolitischen Pfad. In Großbritannien hat die Inflation das zentrale Ziel der britischen Notenbank lange Zeit überschritten. Der Rückgang auf zuletzt 1,7 % gg. Vj. gibt den Währungshütern nun den nötigen Spielraum, ihre extrem lockere Geldpolitik noch weiter fortzusetzen, wenngleich sich die konjunkturelle Situation zuletzt stetig verbessert hat. Entsprechend rechnet man weder für diesen noch für die kommenden Monate mit einer Anpassung des Leitzinses. Die BoJ hat die deflationären Tendenzen zuletzt dank der massiven Abwertung des Yen in den Griff bekommen und dürfte deshalb auf der Sitzung am Dienstag auch die Hände stillhalten.In den USA steht kommende Woche zwar keine geldpolitische Entscheidung an, dafür dürfte das Sitzungsprotokoll am Mittwoch aber Aufschluss über die Beweggründe für die jüngsten Feinadjustierungen geben. Wenig überraschend war dabei, dass die Reduzierung der monatlichen Anleihenkäufe vorangetrieben wurde, denn die zeitweise auftretende konjunkturelle Schwäche war wohl vor allem auf den harten Winter und damit einem temporären Faktor zurückzuführen. Auch die Abschaffung des Schwellenwertes von 6,5 % bei der Arbeitslosenquote in Bezug auf die „forward guidance“ war soweit erwarten worden, denn der Rückgang der Arbeitslosenquote in Schlagdistanz zum angeführten Schwellenwert war weniger auf die Besserung der Beschäftigungssituation zurückzuführen als vielmehr darauf, dass viele die Suche nach einem Job mangels guter Aussichten aufgegeben haben und so aus der Statistik gefallen sind. Die Fed hat im März verkündet, eine mögliche Zinserhöhung fortan an einen qualitativeren Ansatz aus Inflation, Inflationserwartungen und einer breiteren Beurteilung des Arbeitsmarktes zu koppeln. Was derweil für Überraschung sorgte war zuletzt die Aussage der Fed-Präsidentin Yellen, wonach rund sechs Monate nach Beendigung des Anleihenkaufprogramms mit einer ersten Zinserhöhung zu rechnen sei. Gleichzeitig wurden die Medianerwartungen der FOMC-Mitglieder bezüglich der Entwicklung der Fed Funds Rate nach oben korrigiert (Ende 2016: 2,25 % statt 1,75 %), was die Zinserhöhungsphantasien der Marktteilnehmer beflügelt hat. Das Sitzungsprotokoll sollte die Gründe für die erneuerte Einschätzung offenlegen. In Deutschland steht kommende Woche derweil vor allem die Entwicklung der Industrieproduktion im Fokus. Grundsätzlich sind die Weichen für ein Anziehen der Produktionsaktivität im 1. Quartal gestellt. Die hohe Dynamik vom Januar (0,8 % gg. Vm.) dürfte aber nicht zu wiederholen sein.