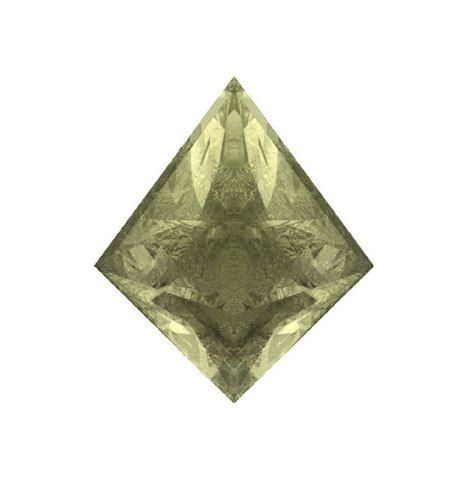In Deutschland profitierte die Industrie diesen Winter von ungewöhnlich milden Temperaturen. Auf der anderen Seite des Atlantiks kam es zum anderen Wetterextrem. Hier war es in einigen Teilen des Landes deutlich kälter und schneereicher als üblich, und das hat Bremsspuren bei der konjunkturellen Erholung hinterlassen. Aktivitäten im Bausektor wurden massiv behindert, die Produktion ist entsprechend ins Stocken geraten. Auch die privaten Haushalte hatten ihre Mühen mit dem Wetter, der Gang in die Geschäfte war deutlich erschwert. Im 1. Quartal dürfte vor diesem Hintergrund nur ein gedrosseltes Wachstum von 1,3 % (ann.) erzielt worden sein. Umso spannender ist es nun zu beobachten, wie stark die Aufholeffekte ausfallen, die mit den milderen Temperaturen einsetzen sollten. Die Frühindikatoren weisen diesbezüglich erst auf eine leichte Belebung hin. Der ISM-Index im Verarbeitenden Gewerbe ist von 53,2 auf 53,7 Punkte gestiegen, die Stimmung im Dienstleistungssektor hat sich von 51,6 auf 53,1 Punkte verbessert. Und auch die Verbraucher zeigen sich wieder besser gelaunt. Wir rechnen für das heute zur Veröffentlichung anstehende Konsumentenvertrauen der Universität Michigan mit 81,5 Punkten und damit mit einem um 1,5 Punkte besseren Wert als im Vormonat. Insgesamt dürften die Verbraucher in den USA dabei honorieren, dass seitens der Fiskalpolitik in diesem Jahr weniger Belastung entsteht und sich zudem die Situation am Arbeitsmarkt verbessert. Dem entgegen stehen veränderte regulatorische Rahmenbedingungen in Bezug auf Hypothekendarlehen und schlechtere Finanzierungskonditionen für Immobilien, die auf die Laune der Verbraucher drücken könnten. Per Saldo rechnen wir deshalb damit, dass der Konsum in diesem Jahr mit 2,5 % ähnlich stark wächst wie 2013. Auf dem Frühjahrsgipfel vom IWF und der Weltbank kommen heute alle globalen Problemfelder auf den Tisch. Neben den Konsequenzen aus der Ukrainekrise werden wohl die Deflationsgefahren in der Eurozone und die Konsequenzen des Einstieg in den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik der Fed diskutiert. Die Marktreaktionen sollten sich aber in Grenzen halten.Erwartungsgemäß unspektakulär gestaltete sich die gestrige Sitzung der britischen Notenbank. Die Währungshüter hielten an ihrer Politik der ruhigen Hand fest, der Leitzins blieb entsprechend bei 0,5 %. Alles andere als eine Fortsetzung des extrem lockeren Kurses wäre eine Überraschung gewesen, denn die Situa- tion am Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Wochen nicht signifikant weiter verbessert. Zudem ist die Inflation gerade erst auf ein neues zyklisches Tief gerutscht, so dass die Bank of England nicht in Eile war, geldpolitisch gegenzusteuern. Bis August sollten kaum neue Erkenntnisse von der Notenbanksitzung ausgehen, dann steigt die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs etwas an, denn dann werden drei der neun Plätze im geldpolitischen Ausschuss neu besetzt. Zudem sollte sich die Datenlage in Bezug auf die Produktivität und das Lohnwachstum – zwei Größen, denen die Bank of England im Rahmen der „forward guidance“ verstärkt Beachtung schenkt – verbessert haben, so dass die Würfel im Spätsommer neu gemischt werden. Das britische Pfund zog zum Euro gestern den Kürzeren. Die Einheitswäh- rung zeigte sich durch die überraschend erfolgreiche Griechenland-Auktion im Aufwind. Zur britischen Valuta wurden Notierungen von mehr als 0,8270 GBP realisiert, zum US-Dollar hat der Euro nur knapp die 1,39 USD verpasst. In Frankreich sorgte die Veröffentlichung der finalen Inflationszahlen für März für eine erneute Überra- schung der negativen Art. So ist die Teuerung im Betrachtungsmonat von 0,9 % auf 0,6 % gg. Vj. und damit tiefer als erwartet (0,7 %) gerutscht. Wenngleich niedrigere Energiepreise die Entwicklung dominieren, ist auch die Kernrate im Jahresvergleich deutlich von 0,7 % auf 0,4 % gefallen. Per Saldo haben die disinflationären Tendenzen weiter zugenommen – keine gute Nachricht für die EZB.